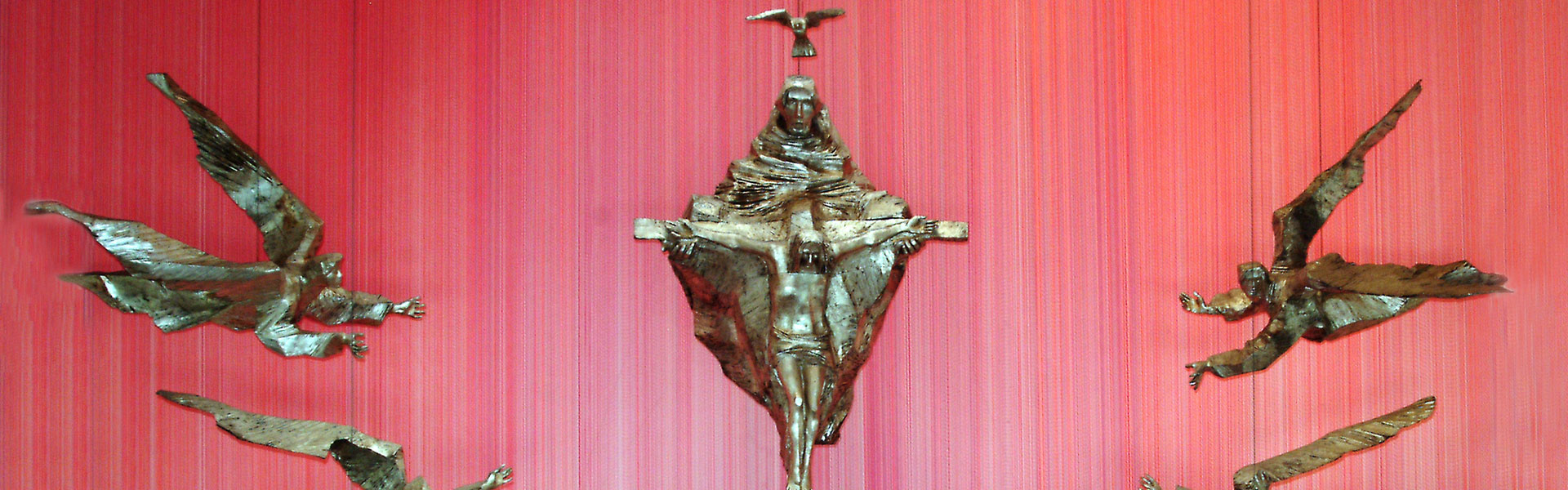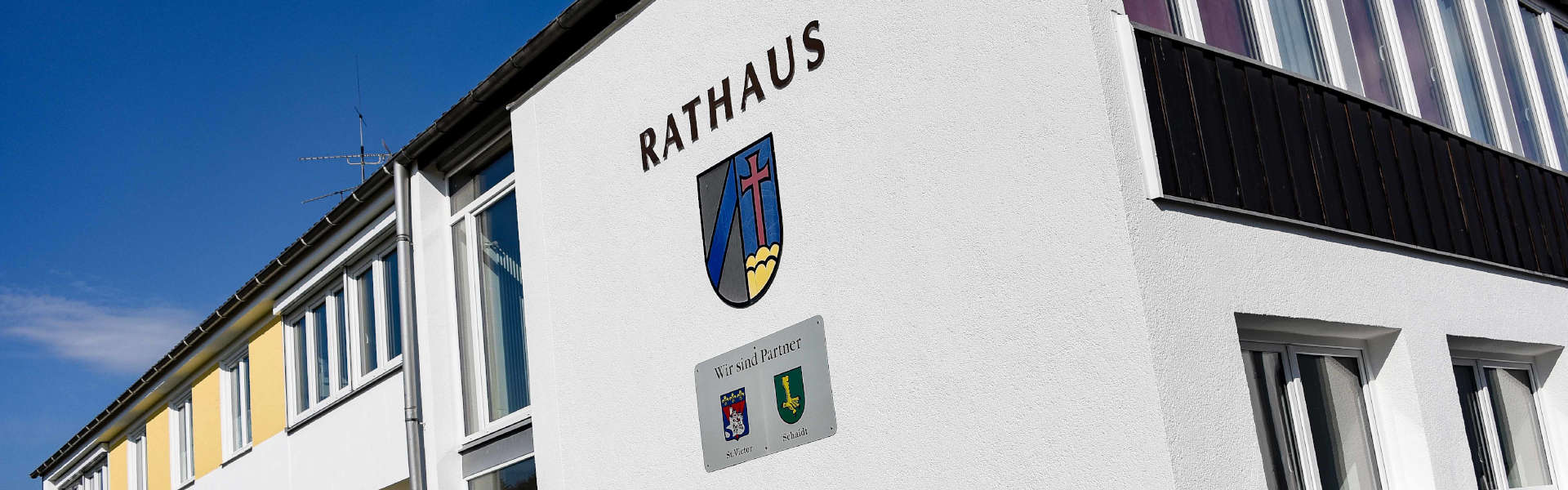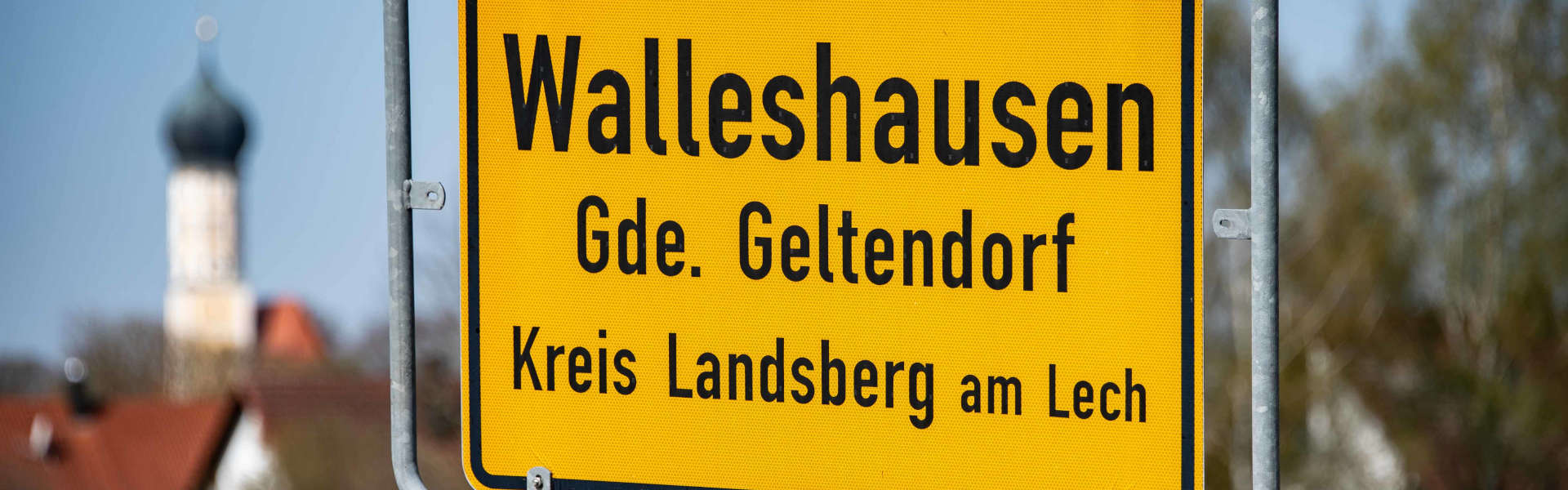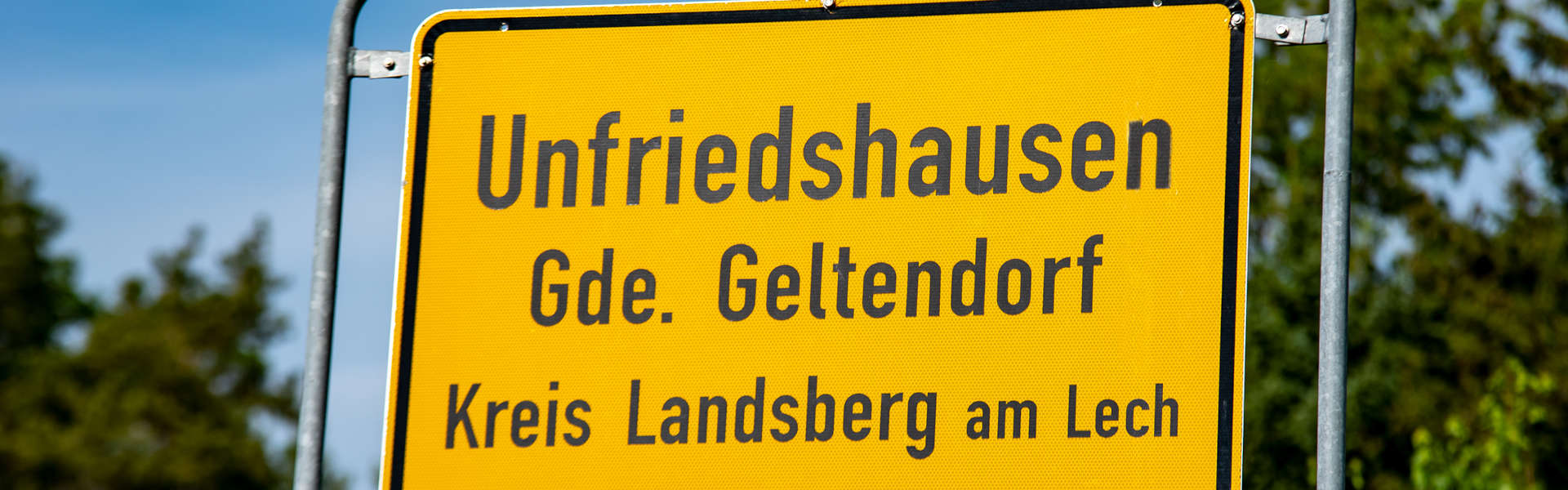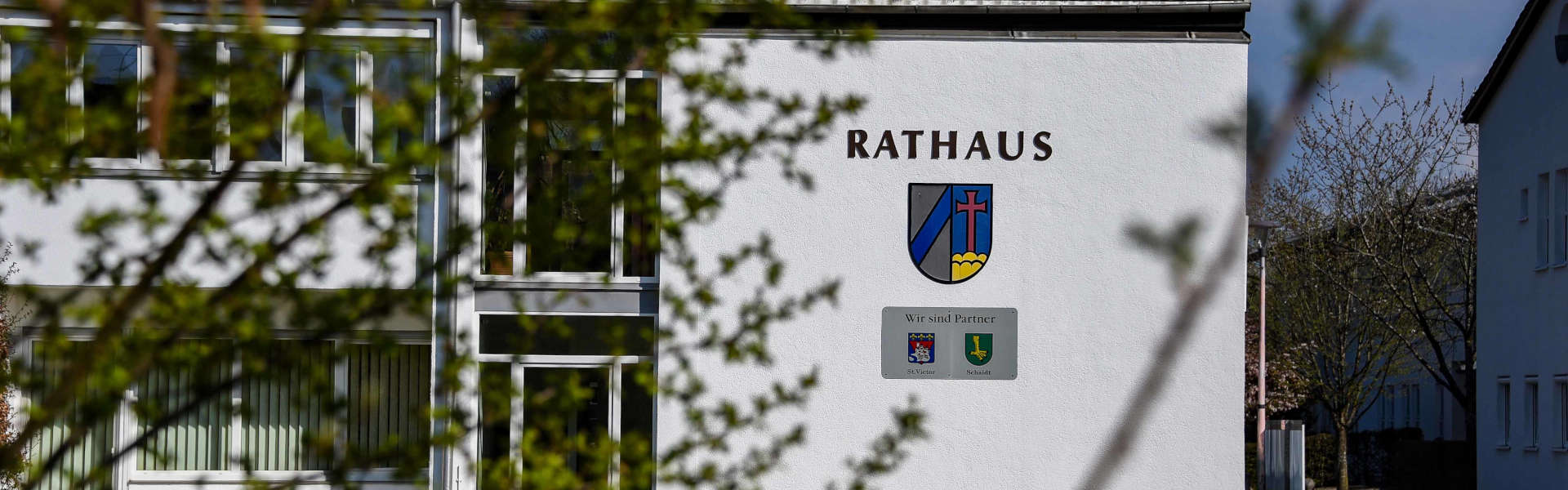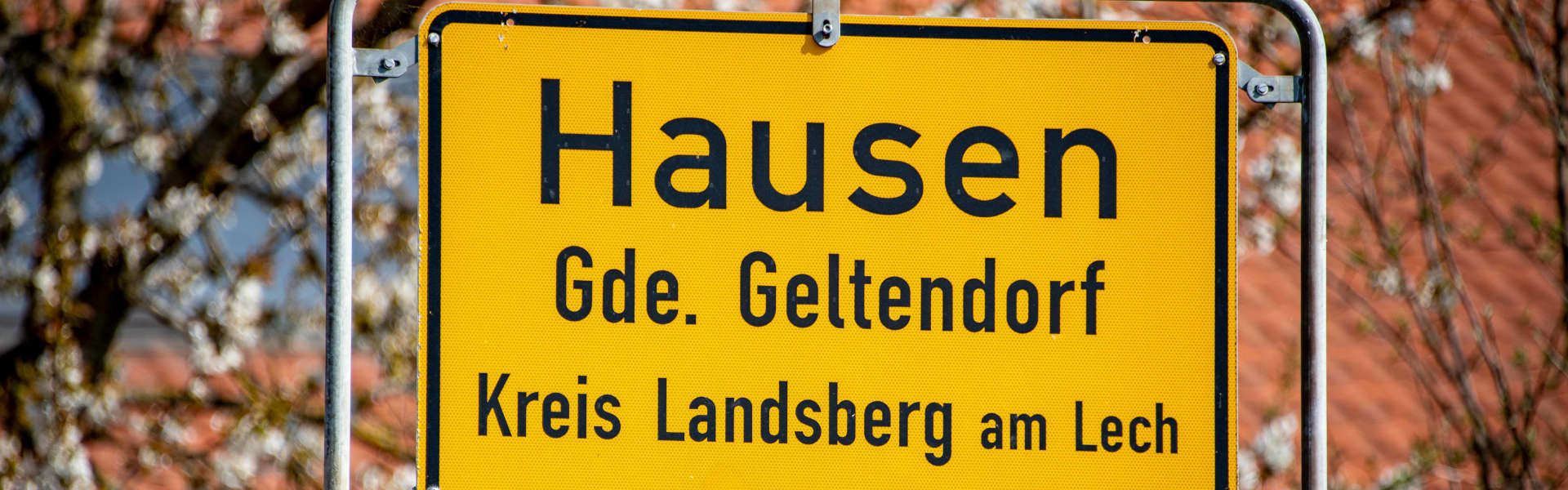Wie hängen das Wärmeplanungsgesetz und das Gebäudeenergiegesetz zusammen?
Am 1. Januar 2024 treten gleichzeitig mit dem Wärmeplanungsgesetz Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in Kraft. Das GEG befasst sich in Abgrenzung zum WPG nicht mit dem Thema Planung und den Anforderungen an Wärmenetze, sondern enthält konkrete Vorgaben für Heizungsanlagen in Gebäuden. Neu eingebaute Heizungen müssen danach künftig grundsätzlich 65 Prozent der mit der Anlage bereitgestellten Wärme mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme erzeugen (sog. 65-Prozent-EE-Vorgabe).
Die Anforderungen sind technologieoffen ausgestaltet. Das GEG sieht – neben einem individuellen Nachweis auf Grundlage von Berechnungen – verschiedene pauschale Erfüllungsoptionen zur Einhaltung der 65-Prozent-EE-Vorgabe vor. Eine Erfüllungsoption ist der Anschluss an ein Wärmenetz. Das GEG enthält daher auch Verknüpfungen zur Wärmeplanung.
So gilt die 65-Prozent-EE-Vorgabe des GEG einschließlich der Übergangsfristen des GEG für Bestandsgebäude und Neubauten außerhalb von Neubaugebieten, bei denen es sich um einen Lückenschluss handelt, erst mit Ablauf der Fristen, die das Wärmeplanungsgesetz für die Erstellung von Wärmeplänen vorsieht. Ab wann die 65-Prozent-EE-Vorgabe gilt, hängt daher von der Größe des Gemeindegebiets ab. In einem der o. g. Gebäude, das in einem Gemeindegebiet mit 100.000 oder weniger Einwohnern liegt, kann bis zum Ablauf des 30. Juni 2028 eine Heizung eingebaut werden, die nicht die 65-Prozent-EE-Vorgabe erfüllt. Befindet sich das Gebäude in einem Gemeindegebiet mit mehr als 100.000 Einwohnern, gilt dies bis zum 30. Juni 2026. Damit wird es Bürgerinnen und Bürgern ermöglicht, sich bei der Entscheidung für eine klimafreundliche Heizung an den Inhalten der Wärmepläne zu orientieren.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/faqs/Webs/BMWSB/DE/kwp/kwp-liste.html
Was ändert sich für Einwohnerinnen und Einwohner?
Die Wärmeplanung berührt die Bürgerinnen und Bürger nicht unmittelbar, wenngleich eine breite freiwillige Partizipation am Prozess der Wärmeplanung vorgesehen und wünschenswert ist. Am Ende des Prozesses werden, aber Bürgerinnen und Bürger mehr Klarheit über die ihnen voraussichtlich zur Verfügung stehenden Wärmeversorgungsarten haben. Eigentümerinnen und Eigentümer von Grundstücken können somit besser planen, welche Investitionen in die Energieversorgung zu welchem Zeitpunkt die für sie wirtschaftlichste ist.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/faqs/Webs/BMWSB/DE/kwp/kwp-liste.html
Welche Austauschpflichten sind nach dem Gebäudeenergiegesetz zu beachten?
Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden und müssen daher grundsätzlich ausgetauscht werden (vgl. § 72 Abs. 1 GEG). Jüngere Heizungen (Einbau oder Aufstellung nach dem 1. Januar 1991) dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden (vgl. § 72 Abs. 2 GEG). Ausnahmen bestehen etwa für Niedertemperatur-Heizkessel, Anlagen mit einer geringen Nennleistung oder Hybridheizungen (vgl. § 72 Abs. 3 GEG).
Mit Ablauf des Jahres 2044 ist es endgültig verboten, Heizkessel mit fossilen Brennstoffen zu betreiben (vgl. § 72 Abs. 4 GEG). Sie müssen also entweder ausgetauscht oder mit 100 Prozent klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden.
Quelle: https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
Welche Auswirkungen hat die kommunale Wärmeplanung auf das Gebäudeenergiegesetz?
Bis zum Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung können Eigentümer von Bestandsgebäuden grundsätzlich weiterhin frei darüber entscheiden, welche Heizung sie im Falle eines Austauschs neu einbauen.
Das Erfordernis von 65 Prozent erneuerbarer Energien (§ 71 Abs. 1 GEG) an der bereitgestellten Wärme gilt für neu einzubauende Heizungen im Bestand erst mit Ablauf der sog. Übergangsfristen:
- Ablauf des 30.06.2026 in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern
- Ablauf des 30.06.2028 in Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger
Das Erfordernis von 65 Prozent gilt schon früher, wenn die Gemeinde während der Übergangsfrist in Folge eines Wärmeplans die Entscheidung über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes trifft. In diesem Fall gilt das 65 Prozent-Erfordernis für Bestandsgebäude bereits einen Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung (vgl. hierzu insgesamt § 71 Abs. 8 GEG).
Heizungen, die mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickt und die während dieser Übergangsfrist eingebaut werden, müssen beginnend ab 2029 jedoch mit einem stetig steigenden Anteil an Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden (zunächst 15 Prozent, vgl. § 71 Abs. 9 GEG).
Bis zum tatsächlichen Anschluss an ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz gelten anschließend an oben benannte Fristen weitere Übergangsfristen (vgl. § 71j, 71k GEG).
Quelle: https://www.stmwi.bayern.de/energie/energiewende/kommunale-waermeplanung-in-bayern/
Was zählt im Wärmeplanungsgesetz zu den Erneuerbaren Energien?
Im Gesetz sind verschiedene Optionen zur Erzeugung von Wärme ohne fossile Brennstoffe aufgeführt, die als erneuerbare Energien oder unvermeidbare Abwärme anerkannt werden. Hierzu zählen beispielsweise Geothermie, Umweltwärme, Abwasserwärme, Solarthermie, Biomasse, grünes Methan, grüner Wasserstoff, Strom aus Erneuerbaren Energien und unvermeidbare Abwärme, beispielsweise aus Industrien, Abwasser und Rechenzentren.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/faqs/Webs/BMWSB/DE/kwp/kwp-liste.html
Ist der Wärmeplan, vor allem die Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete, verbindlich?
Die Wärmeplanung ist eine strategische Planung. Eine grundstücksscharfe Einteilung in Wärmeversorgungsgebiete wird in vielen Fällen (noch) nicht möglich sein. Die Ergebnisse der Wärmeplanung sind rechtlich nicht verbindlich. Ein Anspruch auf eine bestimmte Versorgung besteht nach dem Wärmeplanungsgesetz nicht.
Quelle: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/faqs/Webs/BMWSB/DE/kwp/kwp-liste.html
Zeigt der Wärmeplan auf, wann man sich an ein Wärmenetz anschließen kann?
Nein, denn das soll und kann der Wärmeplan nicht. Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung ist es aufzuzeigen, wo welche Wärmeversorgungsart mit welchem klimaneutralen Energieträger prinzipiell möglich ist. Aus der Wärmeplanung können keine Ausbaugarantien oder Terminaussagen für den Anschluss an Wärmenetze abgeleitet werden.
Es wird auf der anderen Seite aber deutlich, wo, aller Voraussicht nach, kein Wärmenetz entstehen wird und sich die Gebäudeeigentümer wie bisher auch, individuell um die Wärmeversorgung kümmern müssen.